Manchmal ist der Einstieg in ein Thema einfach. Manchmal nicht. Also warum nicht mal so umständlich wie irgend möglich ins Thema einsteigen? Hier also mein geistiger Seitfallzieher vom Fünfmeterturm:
Millionen Jahre lang lebte die Menschheit wie die Tiere. Dann geschah etwas, das die Kraft unserer Phantasie freisetzte. Wir lernten zu sprechen und wir lernten zuzuhören. Die Sprache hat die Kommunikation von Ideen ermöglicht und die Menschen in die Lage versetzt, zusammenzuarbeiten und das Unmögliche zu schaffen. Die größten Erfolge der Menschheit sind durch Reden entstanden, die größten Misserfolge durch Nichtreden. Das muss nicht so sein. Unsere größten Hoffnungen könnten in der Zukunft Wirklichkeit werden. Mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht, sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Wir müssen lediglich dafür sorgen, dass wir weiter miteinander reden.
Das Zitat habe ich aus dem Song „Keep Talking“, ein Song der Progressive Rock Band „Pink Floyd“. Steven Hawking sagt unter anderem, dass wir es uns nicht erlauben können, nicht zu reden. Und trotzdem beobachte ich genau das.
Also, über was reden wir hier? – Fallbeispiele
Zum Beispiel bei einem Tischgespräch mit Kollegen nach der Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump Anfang September 2024. Auf offene Fragen kamen mehrfach eher ausweichende und kurze Antworten. Ich hatte ein Bekenntnis zur eigenen Meinung erwartet, aber sehr harmoniebedachte Positionen zur Meinungsfreiheit und Demokratie bekommen.
In einem anderen Gespräch hat mir ein Kollege von Ideen für eine Reform des Amerikanischen Wahlsystems erzählt. Auf meine Frage, warum er darüber nicht offen reden würde, meint er, dass Reden mit Gleichgesinnten nichts verändere und mit Andersdenkenden noch weniger. Also reden wir beim Essen weiter über Hunde, die Sportergebnisse oder das Wetter.
Auf der anderen Seite habe ich im Sommer eine Konversation einer Gruppe junger Menschen in Barton Springs, einem öffentlichen Schwimmbad in Austin, mitbekommen. Bis auf zustimmendes „Yeah man!“ und „Dude!“ aus der Gruppe, war es mehr ein Monolog eines ausgewachsenen Jugendlichen Anfang Mitte zwanzig über sein Dating-Leben. Nach 10 Minuten hatte ich immer noch nicht begriffen, was er mitteilen wollte.
Eine andere Art von Monolog habe ich auf dem „Texas Renaissance Fest“ beobachtet: Beiläufig beobachte ich eine Frau, die auf einen Typen einredet, der sich gerade an einer Hähnchenkeule erfreut. Sie meint, dass er rücksichtslos sei und ob er sich Gedanken über das Tier und das Klima mache. Und während ich selbst Vegetarismus unterstütze, habe ich mich gefragt, welches Ziel diese Frau mit dem unverhohlenem Angriff erreichen möchte.
Im Kontrast dazu genieße ich die Diskussion über politische Themen mit einem bestimmten Kollegen sehr. Kürzlich hatten wir eine angeregte Debatte über Demographie. Während ich die Meinung vertreten habe, dass ein natürlicher Bevölkerungsrückgang nachhaltig ist, hat er die Position vertreten, dass dadurch im gegenwärtigen Wirtschaftssystem wenige junge Menschen viele alte Menschen versorgen müssen.
Na, weil ich das so sage. – Emotional aufgeladene Debatten
In Diskussionen wie diesen sind wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. Einer von nimmt aus Prinzip die Gegenposition ein. Und obwohl es nicht schick ist, lasse ich mich emotional mitreißen. Schnell habe ich den Stempel, nicht „sachlich“ zu sein und der Dialog kippt zum Streit.
Natürlich ist es toll, wenn man die Distanz beibehalten kann. Kann man nicht einfach Argumente und Gegenargumente vortragen, Punkte für die Argumente vergeben und am Ende einen zum Sieger küren, wie bei einem Boxkampf? Und dann geben sich beide die Hände, betonen wie sehr sie einander und die Konversation schätzen und das Thema wird geschlossen?
Ich glaube nicht, dass das für mich funktioniert. Ich bin emotional in den Debatten, deren Inhalt mich wirklich interessiert. Und wenn mich der Inhalt nicht interessiert, dann lasse ich die Debatte bleiben. Doof wird es, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meinen Gegenüber zu verstehen. Auch wenn ich die Argumente nicht gutheißen muss, möchte ich sie nachvollziehen können. Schließlich möchte ich von jedem Gespräch etwas lernen. Verstehen, wie andere Menschen denken und warum sie so denken.
Ehrlicherweise ist mir das meistens nicht genug. Ich möchte meinen Gegenüber von meiner Position überzeugen. Eine neue Verbündete für meine Idee gewinnen. Denn schließlich habe ich ja Recht, oder? Meine Erfahrung ist eher, dass ich nicht richtig liege. Dass die Realität komplex ist und es selten einfache Antworten gibt. Und selbst wenn ich denke mehr zu sehen, ist es echt schwierig meinen Gegenüber dazu zu bringen, meine Perspektive einzunehmen. Vor allem unmittelbar in der Situation.
Was ist also der Sinn der Debatte, wenn ich nicht erwarten kann, dass jemand seinen Standpunkt ändert? Ich kann immer etwas lernen und meinen Horizont erweitern. Und statt eine neue gemeinsame Wahrheit zu finden, bin ich sehr zufrieden wenn wir beide die Möglichkeit haben, unsere Wahrheit zu hinterfragen.
Das wird man doch sagen dürfen! – Gesprächstaktik
Auch diese Ziele verfehle ich oft genug, weil einer von uns oder beide ganz schön stur sind. Was fällt den anderen auch ein, so überzeugt von ihren Weltbildern zu sein? Im 2024 erschienenen Film „Conclave“ sagt Kardinal Lawrence in einer Predigt zu den Kardinälen, die einen neuen Papst wählen sollen, aber in mehrere Lager gespalten sind: „Gewissheit ist der Feind von Einigkeit.“
Certainty is the enemy of unity.
Kardinal Lawrence, Conclave
Wie also die Gewissheit des Gegenüber aufweichen? Ich habe ein paar Strategien.
Mit wem rede ich?
Je besser ich meinen Gegenüber kenne, desto besser kann ich meine Argumentation anpassen. Das ist kein neues Konzept, sondern wird seit Jahrzehnten in der Werbeindustrie gelebt. Das Zauberwort ist „Zielgruppenorientierung“. Mit viel Empathie kann ich die Motivation meiner Zielgruppe erraten und meine Argumentation entsprechend Anpassen.
Dabei muss meine Zielgruppe auch nicht zwangsläufig meine Gesprächspartnerin oder mein Gesprächspartner sein. Der Ex-Freund einer engen Freundin hat eine starke politische Meinung, von der er allerdings durch kein Gespräch der Welt abzubringen war. Obwohl ich ihn nur schwer von meinen Ideen überzeugen kann, habe ich die Debatte immer wieder gesucht. Wenn wir diskutiert haben und sie zugehört hat, konnte sie Argumente von beiden Seiten hören und die Ansichten übernehmen, die am besten mit ihrem Weltbild vereinbar waren.
Das wäre zu viel gesagt.
Ein Stilmittel vieler Populisten ist die absichtliche Übertreibung. So behauptete die rechtspopulistische CSU 2017, dass durch den Familiennachzug viel zu viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen würden. Und während ich mich im Gespräch mit einem CSU-Wähler auf die Position zurückziehen werde, dass die CSU in diesem Falle rechtspopulistische Propaganda unterstützt hat, verfängt bei einem Teil meiner Zielgruppe die Aussage, dass man der bayrischen Splitterpartei der Christdemokraten nicht trauen kann.
Diese Strategie hat einen Preis: Darunter leidet meine Glaubwürdigkeit als Experte. Aber der geneigte Leser wird ahnen, dass ich gar kein Experte bin und dass das alles nur billiger Populismus ist. Ich möchte an dieser Stelle vom (übermäßigen) Gebrauch dieses Stilmittels abraten. Es untergräbt systematisch das Vertrauen ineinander und eine gesunde Debattenkultur.
Im Kontrast zu einer politisch korrekten und relativistischen Debatte über den Einfluss von Überreichen auf demokratische Prozesse finde ich ein plakatives „Eat the rich!“ dennoch greifbarer und manchmal zielführend. Man kann auch mal eine extreme Position in den Raum werfen um diesen für eine Debatte zu öffnen, ohne die Position verteidigen zu müssen. (Mehr dazu in meinem Artikel „Mehr sozialen Populismus wagen“ von 2021.)
Einfach mal „Danke!“ sagen.
Versöhnlicher ist es natürlich, den Gegenüber ein Punkt machen zu lassen, und sich vielleicht sogar für einen neuen Aspekt zu bedanken. Ich bin deutlich eher bereit, über die Position meines Gegenübers nachzudenken, wenn sie oder er mich mit Respekt behandelt. Außerdem verleiht ein „Danke“ direkt ein staatsmännisches Auftreten.
Im Gegensatz dazu ist es ein Pyrrhussieg, wenn ich die Debatte dominiere, sich danach aber niemand mit mir unterhalten mag. Wenn man es so formulieren mag, ist es besser die Schlacht zu verlieren, als den Krieg. Weniger martialisch ist zu betonen, dass es langfristig viel schöner ist, Gemeinsamkeiten zu finden über die man sich immer wieder verbinden kann. Die können auch ein Ausgangspunkt für weitere Gespräche sein. Und am Ende sitzen wir doch alle im selben Boot.
Memo an mich: Ich möchte in Zukunft öfter andere das letzte Wort haben zu lassen. Deshalb interessiert mich brennend, was Du als Leserin oder Leser von diesem Artikel hältst, welche Erfahrungen Du in Dialogen schon gemacht hast und welche deine Gesprächsstrategien sind. Ich freue mich über deinen Kommentar.
Was ich noch sagen wollte:
- Wenn du magst, kannst Du dein Debattentalent im Format „Deutschland spricht“ der Zeit verfeinern
- Die Comedy-Serie Scrubs hat in der Folge „His Story“ die polarisierenden Debatte unterhaltsam aufbereitet
- Ich bin bei der Recherche zu diesem Artikel in das rabbit hole „Zitate zuordnen“ abgestiegen und wollte das unbedingt mit euch teilen
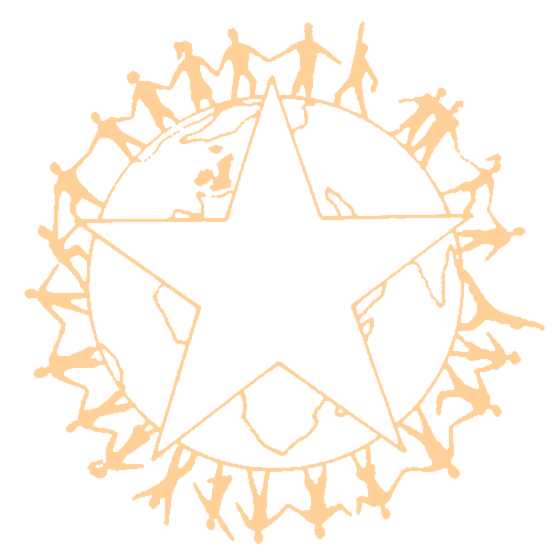
Neueste Kommentare