Seit 20 Jahren verändert sich politisch kaum etwas. Dazu hat auch das nunmehr 16 sehr lange Jahre andauernde Angelozän beigetragen. Das muss erstmal nicht schlecht sein. Die Regierungen unter Angela Merkel haben durch minimalstinvasive Politik eine eigene Art der Stabilität geschaffen. Den Status quo zu halten ist allerdings nur für diejenigen von Interesse, die damit eigentlich ganz zufrieden sind oder sogar davon profitieren. Dazu gehören wohl die allermeisten in diesem Land nicht und dennoch sind die Chancen, dass dieses Land und Europa auch in der kommenden Legislaturperiode von Lethargie und Konservatismus geprägt werden, gar nicht mal schlecht. Wo sind sie also, die nicht vom Ist-Zustand profitieren?
Erklärungsversuche
Zum einen gibt es einen nicht unerheblichen Teil, der dem „American Dream“ verfallen ist, in der festen Überzeugung, dass „wenn man nur hart genug arbeite, werde man auch irgendwann zu den Privilegierten gehören“. Dieser Ansatz impliziert die Erklärung warum man (noch) nicht zu den Wohlhabenden gehört: Man hat einfach nicht hart genug gearbeitet.
Wenngleich einiges durch Arbeitsaufwand erreicht werden kann, ist dieser Traum für die meisten doch eine zunehmende Illusion. Es gibt durchaus mehr Faktoren, die den Erfolg beeinflussen: Bildung, Persönlichkeitsmerkmale, finanzielle Ausgangslage, Flexibilität und neben vielem mehr auch immer ein nicht unbedeutender Bestandteil Glück. Während einige dieser Startvoraussetzungen bist zu einem gewissen Grad beeinflusst werden können, gibt es andere, die uns in die Wiege gelegt werden und mit denen wir fortan zurecht kommen müssen. Während Wohlhabende ihre Kinder auf Privatschulen schicken, ihnen Zugang zu Stipendien ermöglichen und problemlos Wohnungen in Uni-Städten mieten oder sogar kaufen können, bleiben diese Privilegien vielen vorenthalten. Auch BAföG kann in seinem derzeitigen Umfang diese Ungleichheiten nicht beseitigen.
De facto gibt es eine wachsende Ungleichheit in Deutschland und das führt dazu, dass jener „American Dream“ nur noch bedingt funktionieren kann. Die soziale Mobilität nimmt ab (Anmerkung des Autors: Und das mag was heißen, wenn sogar die FAZ darüber berichtet.). Je nach Auslegung gibt es also für die unteren 40-90% in Deutschland überhaupt keinen Grund, den Status quo aufrecht erhalten zu wollen.
Wie lässt sich dann aber erklären, dass soziale Parteien dennoch keine Mehrheiten bei Wahlen erringen können? Die Antwort darauf ist sicher weder monokausal noch einfach. Ich möchte mir nicht anmaßen, das vollumfänglich erklären zu können, aber einen Ansatz möchte ich hier anbringen: Vielen Wählern ist nicht klar, wo sie aktuell in der Gesellschaft stehen, wie sich unsere Gesellschaft kurz-, mittel- und langfristig entwickeln wird und wie sie das in ihrem Interesse beeinflussen können. Dass die Welt sehr komplex ist, viel komplexer als ich mit meinem beschränkten Geist zu erfassen in der Lage bin, ist mir durchaus bewusst. Deshalb muss ich mich auf wesentliche Dinge beschränken und klare Prioritäten setzen.
Ein Negativbeispiel ist das Wahlprogramm der SPD (wobei das den Wahlprogrammen der übrigen Parteien in Sachen Komplexität kaum nachsteht): Auf der ersten Seite werden fünf Punkte genannt, die mit einem kurzen Satz erklärt werden.
I. Zukunft. Respekt. Europa.
Der Klimawandel, die Arbeit von morgen, Chancengerechtigkeit, der Zusammenhalt der Gesellschaft, die Einheit Europas – das sind die Themen, die unsere Zukunft bestimmen.
SPD zukunftsprogramm 2021
Was genau nun Respekt und Arbeit von morgen mit dem Klimawandel und der Chancengleichheit zu tun haben, oder was den gesellschaftliche Zusammenhalt mit der Einheit Europas und alles zusammen mit Zukunft verbindet? Ich kann es intuitiv nicht sagen. Es bleibt sehr abstrakt, die Punkte sind mehr eine Akkumulation verschiedener Buzzwords und die Inhalte bleiben vage. Auch ein Klick auf die detaillierte Erläuterung hilft nicht viel: Zunächst werden Fragen aufgeworfen, die im weiteren Verlauf allerdings nicht wirklich beantwortet werden. Vielmehr gibt es viel Kritik und schöne Visionen einer utopischen Zukunft. Es ist allerdings wenig Greifbares dabei, es mangelt an konkreten Ideen für die Beantwortung der vielen, vielen Fragen.
Persönlich fühle ich mich von sehr konkreten Überschriften deutlich eher angesprochen. Und das geht wohl auch den meisten BILD-Lesern so. Wenngleich ich dieses Medium missbillige, kann ich seinen Methoden eine Erkenntnis abringen: Natürlich kann man so die Sachlage in all ihrer Komplexität nicht vollständig abbilden. Das ist aber meiner Meinung nach auch nicht die Aufgabe der Politik, sondern der Wissenschaft. Durch Steuergelder werden die Abgeordneten unserer parlamentarischen Demokratie dafür bezahlt, Probleme in ihrer Komplexität zu erfassen und dezidierte Entscheidungen zu treffen. Die Kommunikation mit dem Wähler, ob über Wahlprogramm, Pressekonferenz oder Medien, muss aber keinem wissenschaftlichen Anspruch genügen, sondern darf durchaus eine einfache Abbildung der Realität sein. (Wer sich informieren will, soll dies selbstverständlich auch weiterhin tun können und auch gerne tun!) Populismus ist ein valides Instrument demokratischer Politik.
Genau das haben Rechtspopulisten (inklusive der oben genannten BILD-„Zeitung“) erkannt und fangen Wählerstimmen mit sehr simplifizierten Aussagen. Mit diesen Aussagen erreichen sie den durchschnittlich gebildeten und durchschnittlich interessierten Bürger. Auch soziale Parteien könnten von aufs Wesentliche reduzierten Aussagen und konkreten Forderungen profitieren. Allerdings ist Populismus in diesen Kreisen ein in Verruf geratenes Instrument. Denn selbstverständlich polarisiert Populismus und kann somit zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Deshalb braucht es Diskurs und Begegnung, öffentlichen Meinungsaustausch und Streitgespräche auf dem Marktplatz. Am besten ohne argumentum ad hominem und so, dass die Würde des Gegenüber gewahrt bleibt. Wir brauchen weniger destruktiven Populismus zugunsten von konstruktivem Populismus.
Forderung
Auch wenn ein komplexes und vollumfängliches Wahlprogramm für eine Regierungsbildung bestimmt von Vorteil ist und eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen den Parteien schafft, fordere ich zumindest eine Priorisierung mit konkreten Vorschlägen. Zum Beispiel:
I. Aufhebung des Steuergeheimnis
Es gibt ein öffentliches Interesse daran zu wissen, welcher Bürger welches Einkommen hat und wie er dieses versteuert. Um Ungleichheit, Steuerflucht und -vermeidung effektiv entgegenwirken zu können, müssen diese und deren Ursachen erst identifiziert werden. Es darf kein Recht auf Verschleierung finanzieller Abhängigkeiten geben.
II. Abgeordnete zu Transparenz verpflichten
Ein Bundes- oder Landtagsmandat ist eine Vollzeitbeschäftigung, bei der die Wahrung der Wählerinteressen immer im Vordergrund stehen muss. Beeinflussung, Korruption, Bestechlichkeit, Vorteilnahme und Interessenkonflikte müssen durch Transparenz für Spenden ab dem ersten Euro und ein öffentliches Lobbyregister entgegengewirkt werden. Jeder Bürger hat das Recht darauf zu erfahren, aus welchem Interesse seine Vertreter Entscheidungen treffen.
III. Erbschaftssteuer erhöhen
Finanzielle Ungleichheit manifestiert sich über Generationen und behindert die soziale Mobilität maßgeblich. Um die Ausgangsbedingungen der Bürger unabhängig von der sozialen Herkunft anzugleichen, müssen Erbschaften, die ein festzulegendes Volumen überschreiten, erheblich progressiver besteuert werden. Das ist ein Beitrag zur generationengerechten und nachhaltigen Chancengleichheit.
IV. Grunderwerbssteuer erhöhen
Spekulation mit Mietimmobilien fügt der Gesellschaft erheblichen Schaden zu. Mit Ausnahme für den Eigenbedarf muss die Grunderwerbssteuer so erhöht werden, dass kurz- und mittelfristige Anlagen in Immobilen unrentabel werden.
V. Branchenunabhängigen Mindestlohn auf 13 €/h erhöhen
Prekär Beschäftigte im Niedriglohnsektor können mit dem aktuellen Mindestlohn trotz Vollzeit (und Anstieg des Mindestlohns bis 2022) nicht immer ein würdiges Leben führen. 13 € ist die Untergrenze dessen, was eine Stunde Arbeit wert sein darf. Damit wird ein sozialer Mindeststandard gesetzt, der ein Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe und ohne Armut ermöglicht.
Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels, die bis zum 7.12.22 online war, habe ich 12 €/h Mindestlohn gefordert. Diese Forderung habe ich auf 13 €/h angeglichen.
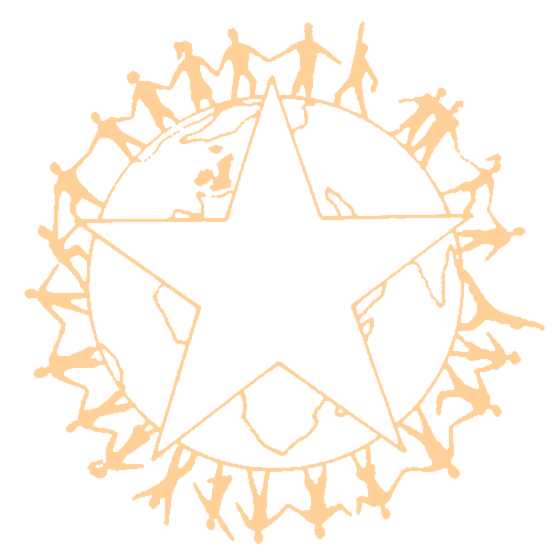
0 Kommentare
1 Pingback