Mit ausgewählten Freund*innen habe ich diese Theorie diskutiert. Jetzt habe ich einen wunderbaren Anfang gefunden: Am Dienstag habe ich Cyberpunk 2077 das erste mal durchgespielt. Deshalb an dieser Stelle: Vorsicht! Spoiler-Alarm!
Während Generationen vor uns den Buchdruck, Radioübertragung, die Massenproduktion von Tonträgern und die Blütezeit der Filmindustrie erlebt haben, ist nun das Videospiel zweifelsohne die beeindruckendste kulturelle Entwicklung unserer Zeit. Cyberpunk ist ein herausragendes Beispiel für die Bearbeitung philosophischer und kultureller Fragen unserer Zeit. In diesem Kontext ist Cyberpunk 2077 gespielt zu haben, wie Schiller gelesen, Kraftwerk auf Langspielplatte gehört oder „Angst essen Seele auf“ im Kino gesehen zu haben.
Cyberpunk 2077 beschäftigt sich gleich mit mehreren soziokulturellen Fragen. Zum Beispiel wie wir mit technischen Verbesserungen am menschlichen Körper umgehen. Die alternativen Enden hingegen beschäftigen sich mit nichts weniger, als mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Je nachdem, wie man die Gabelungen im Schicksal des Hauptcharakters „V“ wählt, wird diese Frage anders beantwortet. Allen gemein ist meiner Meinung nach das mehr oder weniger erfolgreiche Streben nach Unsterblichkeit.
Der Tod, vor allem der eigene ist kein direktes Tabuthema, aber die Vorstellung irgendwann nicht mehr zu existieren ist so unvorstellbar, dass in meinem sozialen Kreis kaum darüber geredet wird. Ich ignoriere meine eigene Sterblichkeit meistens so gut es geht. Erst wenn nahe Verwandte sterben, werde ich schmerzlich an meine eigne Sterblichkeit erinnert. Wahrscheinlich haben Menschen deshalb verschiedene Strategien entwickelt, sich unsterblich zu machen.
Ewige Jugend
Ob Bäder in Milch, Jungbrunnen oder Drachenblut: Wir haben einen Kult um die Jugend etabliert, dem sich keiner entziehen kann. Wir wollen gesund sein bis ins hohe Alter, wollen keine kahlen Stellen auf dem Kopf und einen durchtrainierten Körper.
Nebst der Tatsache, dass es sich in einem gesunden Körper viel besser aushalten lässt und wir mit dem Alter eine Zunahme an Gebrechen verbinden, laufen wir mit jedem Tag, den wir älter werden, dem unausweichlichen ein Stück entgegen.
Das können wir allerdings vor allem durch die Unbestimmtheit unseres eigenen Todes gut verdrängen. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben mit jedem Tag, den wir leben. Und wenn die Haut sich langsam in Falten legt, der Gang langsamer und der messerscharfe Verstand Stück für Stück durch Altersmilde verdrängt wird, wird es immer schwerer die eigene Sterblichkeit zu verleugnen.
Um die endgültige Perfektion herauszuschieben, gehen wir zum Arzt, trinken viel Wasser, essen das auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Super-Food, machen unser tägliches Workout, tragen Tagescremes auf, lassen uns ein Toupé anfertigen und ab und an ein bisschen Botox. Wann der gesunde Lebensstil zum Jungendkult oder sogar Jugendwahn wird, liegt im gelaserten und gelifteten Auge des Betrachters.
In Geschichten unsterblich
Wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, kennt Karl den Großen, den Vater des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Erzählungen konservieren nicht nur eine Vorstellung davon, woher wir kommen, warum manchen Dinge sind, wie sie sind, sondern beeinflussen unser Denken und Handeln. Damit sind Menschen nicht nur in ihren Handlungen, sondern auch in ihren Narrativen wirksam.
Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.
Berthold Brecht
Berthold Brecht hat es mit einem Satz auf den Punkt gebracht: „Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.“ Erst, wenn sich keiner mehr an den Karl den Großen erinnern kann, es kein Geschichtsbuch mehr gibt, das seinen Namen in sich trägt, er wirklich vergessen ist, beeinflusst er nicht mehr das Weltgeschehen.
Als deutscher Staatsbürger ist mein Weltbild von einer ganz furchtbaren Geschichte geprägt: Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Welt von Menschen mit faschistischer Ideologie heimgesucht und verwüstet. Dabei wird das Narrativ derer, die diese Ereignisse maßgeblich beeinflusst haben, sicher von dem abweichen, was ich heute erzählen werde. Sie standen auf einer anderen Seite der Geschichte. Erst meine Erzählung fügt eine Wertung hinzu. Auch sie sind auf ihre Art und Weise unsterblich.
Es gibt immer Menschen, die Geschichten erzählen. Und darunter gibt es auch heute gefährliche Narrative. Erzählungen von Überlegenheit und Stärke, von Ansprüchen aus Tradition, von Vergeltung und von selbsternannten Opfern, die zurückfordern, was ihnen zustünde.
Die Verbreitung von Erzählungen hat einen Einfluss. Welche Geschichten ich wem und wie erzähle verändert Denken und Handeln. Deshalb möchte ich die Geschichten reflektieren, die ich erzähle. Ich möchte Narrative bewusst und mit einer Intension verbreiten.
Dazu eine Idee aus einem Reddit-Post: In welchem Kontext wird dein Name das letzte mal fallen? Mit was verbindet dich der Mensch, der das letzte mal an dich denkt?
Meine Kinder sind ein Teil von mir
Auch wenn wir uns als rational darstellen, sind wir als Lebewesen auf Arterhaltung programmiert. Unsere Sexualität und der Impuls uns fortpflanzen zu wollen sind fest in uns verankert. Hormone steuern unsere sexuelle Entwicklung, beeinflussen unser Verlangen nach Sex, die Freude daran, Schwangerschaft und Bindung zum Kind. Wir entscheiden uns nicht für oder gegen unsere Sexualität und suchen sie uns auch nicht aus.
Es ist manchmal schwierig unsere Biologie mit unserer Ratio zu vereinbaren. Insbesondere die Narrative um unsere biologische und sexuelle Identität, zum Beispiel Ethnozentrismus oder Homo- und Transphobie, verstehe ich als Versuch, diesen unbeeinflussbaren Teil von uns zu erklären und zu kontrollieren. Ich muss die Narrative nicht gut finden, kann sie aber nachvollziehen.
Wir wollen für unsere Nachkommen die besten Voraussetzungen schaffen und die besseren Gene oder den leistungslosen ökonomischen Aufstieg weitergeben. Schließlich lebt in unseren Kindern ein Teil von uns weiter.
Ideen sterben nicht
Eine Beobachtung, eine Abstraktion, ein Konzept und ein Modell sind sehr beständig. Newtons Beschreibung der Schwerkraftwirkung und Einsteins Modell von Raumzeit überdauern beide.
Während Geschichte vom Standpunkt des Erzählenden abhängt, sind die Erkenntnisse von Newton und Einstein allgemeiner. Wissenschaft hat zum Ziel allgemeingültige Zusammenhänge zu finden, zu überprüfen und für andere zugänglich zu machen.
Damit haben wir Menschen einen evolutionären Vorteil: Während die Natur auf den Zufall warten muss, bis sie eine vorteilhafte Mutation weitergeben kann, können wir den Generationen nach uns unsere Erkenntnisse zur Verfügung stellen. In der Hoffnung, dass sie die Experimente nicht wiederholen muss, aus dem Wissen ihren Vorteil ziehen kann und das Erbe mit neuen Erkenntnissen anreichern kann.
Im Namen von Ideen können wir aber auch Schaden anrichten: Wenn ich mein Wissen nicht hinterfrage, wird daraus schnell unreflektierter Glauben. Wenn ich meine Ideen anderen aufoktroyiere statt anzubieten, wird daraus ideologische Missionierung. Wenn es mehr um mich, als um die Idee geht, beschädige ich die Glaubwürdigkeit der Idee.
Wenn wir eine originäre Idee uneitel weitergeben, können wir über unser Leben hinaus unsere Gesellschaft beeinflussen.
Die Prämisse der unendlichen Gesellschaft
Eines haben die Erinnerung in Geschichten, die Weitergabe unserer Gene und das Bereitstellen von Ideen gemein: Es muss jemand da sein, der die Geschichten erzählt, der die Kinder aufzieht und der die Ideen versteht. Wir alle sterben mit dem letzten Menschen, der sich an uns erinnert, der Kinder haben möchte und der unser Wissen weiterträgt.
Ich habe hier die Existenz einer Gesellschaft vorausgesetzt. Darf ich das? Unter welchen Umständen kann eine Gesellschaft überdauern? Und was kann ich dazu beitragen, dass meine Gesellschaft lebenswert wird und bleibt?
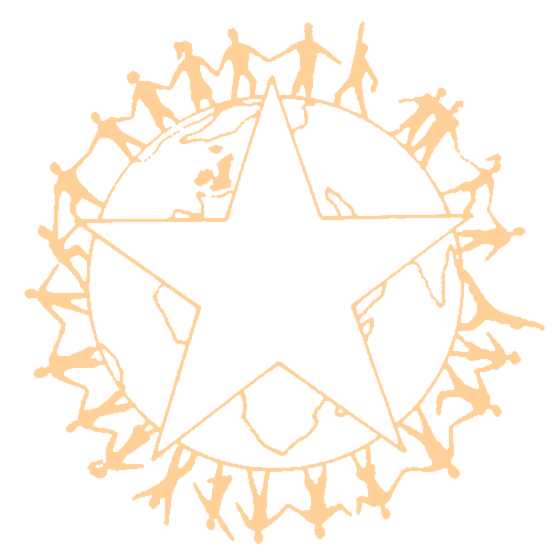
Schreibe einen Kommentar